Bindungsmuster — Nicht mit dir und nicht ohne dich
Eifersucht, Verlustängste, scheinbare Gleichgültigkeit und emotionale Distanz — oder die liebevolle Balance zwischen Nähe und Unabhängigkeit?
Die Art, wie wir als Erwachsene lieben, hat viel mit Bindungsmustern zu tun, die wir in unserer Kindheit gelernt haben.

Bindungsmuster erkennen: Wie unsere Kindheit unsere Beziehungen als Erwachsene prägt
Sicher, unsicher oder desorganisiert?
Ob wir als Erwachsene stabile und erfüllte Beziehungen führen können, hängt stark von unserem Bindungsmuster ab, das wir in der frühen Kindheit gelernt haben.
Je nachdem, wie sicher oder unsicher die Bindung zu unseren Eltern (oder einer anderen Bezugspersonen) war, können wir uns auf Bindungen einlassen — oder tun uns schwer damit.
Die gute Nachricht: Über die Hälfte aller Menschen entwickeln in ihrer Kindheit ein sicheres Bindungsmuster. Als Erwachsene fühlen sich diese Menschen in Partnerschaften wohl, können Nähe zulassen und Vertrauen aufbauen. Diese emotionale Sicherheit geben sie auch an ihre eigenen Kinder weiter.
Die schlechte Nachricht: Wer als Kind ein unsicheres oder desorganisiertes Bindungsmuster entwickelt hat – etwa durch instabile, abweisende oder überforderte Bezugspersonen – hat es später oft schwer, glückliche Beziehungen zu führen. Häufig zeigen sich Muster von Verlustangst, Rückzugsverhalten oder ein ständiges Ringen um Nähe und Distanz.
Aber was sind Bindungsmuster — und wie entstehen sie?
Kindererziehung früher: Wer nicht spricht, fühlt auch nicht?
Begonnen hat die moderne Bindungsforschung Anfang der 1940er-Jahre mit dem britischen Kinderpsychiater und Psychoanalytiker John Bowlby.
Er war einer der Ersten, der wissenschaftlich belegt hat, wie negativ sich eine frühe Trennung von Mutter und Kind auf die emotionale und soziale Entwicklung eines Kindes auswirken kann.
Aufgewachsen in den 1930er und 1940er Jahren: Johanna Haarers “Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind”
Damals eine revolutionäre Erkenntnis, denn nicht nur im nationalsozialistischen Deutschland trieben zu dieser Zeit „Erziehungsexperten“ wie Johanna Haarer ihr Unwesen.
In weiten Teilen Europas übte man in vielen Familien emotionale Zurückhaltung in der Kindererziehung. Eltern wurden eindringlich davor gewarnt, ihre Kinder zu „verhätscheln“ oder gar „zu sehr zu verwöhnen“.
Besonders einflussreich war das Buch „Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind“ von Johanna Haarer, das im nationalsozialistischen Deutschland in den 1930er- und 1940er-Jahren zur Pflichtlektüre für viele Mütter wurde. Es propagierte ein rigides Erziehungsideal: Nähe, Trost und Mitgefühl galten als schädlich für die kindliche Entwicklung.
Die zugrunde liegende Annahme war fatal: Babys, die nicht sprechen können, haben angeblich auch keine echten Gefühle oder Bedürfnisse. Und: Man fürchtete, sie zu manipulativen “kleinen Tyrannen” zu erziehen, würde man sie “verhätscheln”.
Wer nicht spricht, fühlt auch nicht: Deshalb beschränkte sich die „Fürsorge“ für ein Baby in vielen Familien auf das Nötigste: Füttern, Windeln wechseln, schlafen lassen – ohne emotionale Zuwendung. Eine Einstellung gegenüber Kindern, die grausame Blüten trieb: Babys bis zur totalen Erschöpfung weinen und schreien zu lassen, war weit verbreitet.
Noch erschütternder: In manchen Krankenhäusern verzichtete man bei Operationen an Säuglingen sogar auf Narkose, weil man annahm, sie könnten ohnehin keinen Schmerz empfinden.
Dem Geheimnis der Mutter-Kind-Bindung auf der Spur
Um die Bedeutung der Mutter-Kind-Bindung zu erforschen, führte der US-amerikanische Psychologe Harry Harlow in den 1950er-Jahren aufsehenerregende, aus heutiger Sicht jedoch ethisch fragwürdige Experimente an Affenbabys durch.
Harlow trennte neugeborene Rhesusäffchen unmittelbar nach der Geburt von ihren Müttern und setzte sie in Käfige mit zwei künstlichen Mutterattrappen. Die erste bestand aus Draht und trug eine Milchflasche – sie diente der Nahrungsaufnahme. Die zweite bestand aus Holz, war mit weichem Stoff überzogen und erinnerte entfernt an eine Affenmutter, bot jedoch keine Nahrung.
Entgegen Harlows Erwartungen suchten die Äffchen nicht primär die Drahtattrappe mit Milch auf, sondern klammerten sich stundenlang an die weiche, stoffbezogene Ersatzmutter. Zum Trinken liefen sie nur kurz zur Drahtattrappe, kehrten aber sofort zur „Kuschelmutter“ zurück.
Standen beide Attrappen nebeneinander, blieben die Affenbabys fast ununterbrochen auf der weichen Attrappe sitzen, während sie sich beim Trinken zur Drahtfigur vorbeugten – ein deutliches Zeichen dafür, dass Nähe und Geborgenheit über die reine Nahrungsaufnahme hinaus elementare Bedürfnisse sind.
Die Nachuntersuchungen zeigten dramatische Folgen: Die Affen wuchsen sozial isoliert auf, entwickelten schwere Verhaltensstörungen, konnten sich später nicht in Gruppen integrieren und zeigten auffällige Aggressivität und inneren Stress – Symptome, die man heute unter dem Begriff Hospitalismus zusammenfasst.
Wie frühe Erfahrungen unser Bindungsmuster formen
Babys kommen mit einem angeborenen Bedürfnis nach Nähe und Schutz zur Welt – der sogenannte Bindungsreflex.
Diese frühe Bindung zur Mutter oder einer anderen konstanten Bezugsperson ist überlebenswichtig. Instinktiv tun Babys alles, um eine stabile emotionale Verbindung aufzubauen und zu halten.
Mütter in der Opferrolle: Der Mann in der Krise?
In den ersten sechs Lebensmonaten entwickelt sich das grundlegende Bindungsmuster, das unsere späteren Beziehungen maßgeblich beeinflusst. Ob es sicher oder unsicher wird, hängt stark vom Verhalten der Bezugsperson ab.
Hat die Mutter selbst sichere Bindungserfahrungen gemacht, kann sie feinfühlig auf die Signale ihres Babys reagieren. Diese emotionale Verlässlichkeit unterstützt die Entwicklung eines stabilen Bindungsmusters.
Unsichere Bindungserfahrungen der Mutter hingegen können dazu führen, dass sie die Bedürfnisse ihres Kindes verzerrt wahrnimmt. Sie interpretiert Weinen möglicherweise als Trotz oder Manipulation – und reagiert nicht tröstend, sondern abweisend. Es kann dann beispielsweise vorkommen, dass sie ihr Baby nicht tröstet, sondern mit der Begründung schreien lässt, dass es „nur“ trotzig wäre oder sie ärgern wolle.
Solche Fehlinterpretationen aber auch der ständige Wechsel zwischen Liebe, Zuwendung und Zurückweisung können der Beginn einer unheilvollen Kaskade sein.
Babys sind sehr anpassungsfähig.
Sie müssen die Bindung zur wichtigsten Bezugsperson aufrechterhalten, um überleben zu können – auch wenn diese emotional nicht verfügbar oder überfordert ist. Aufstehen, gehen und sich eine liebevollere Mutter suchen, können sie nun mal nicht.
So entstehen oft frustrierende Bindungsmuster, die sich tief ins emotionale Gedächtnis einprägen – und bis ins Erwachsenenalter nachwirken.
Viele Menschen kämpfen dann als Erwachsene mit Unsicherheiten in Beziehungen und Partnerschaften, ohne zu wissen, dass der Ursprung in ihrer frühen Kindheit liegt.
Mutterinstinkt
„ … Der ‘Mutterinstinkt’ lässt sich nicht einfach einschalten, so dass eine Frau, vor allem eine problembeladene, plötzlich eine Bindung zu ihrer kleinen Tochter aufbaut, deren Bedürfnisse kennt, dementsprechend handelt und sie umsorgt. Natürlich ist es falsch, in Freudscher Tradition die Mütter zu Schuldigen zu erklären und ihnen für alle Missgeschicke Vorwürfe zu machen. Doch die Gleichung ‘Mutterrolle = gesunde Liebe’ ist eine Illusion.“
Aus: Susan Forward, Wenn Mütter nicht lieben: Töchter erkennen und überwinden die lebenslangen Folgen*
Die Bedeutung von Bindung in der Kindheit
Die Bindungstheorie, entwickelt von John Bowlby, betont die zentrale Rolle der frühen emotionalen Bindungen für die psychische Entwicklung. Seine Mitarbeiterin und Kollegin Mary Ainsworth ergänzte seine Theorie und entwicklete den Fremde-Situations-Test, mit dem man bis heute Mutter-Kind-Bindungen untersuchen kann.
Für den Test wird ein etwa einjähriges Kind zusammen mit seiner Mutter in einen Raum gebracht, in dem eine Testerin – für das Kind eine fremde Person – sitzt und Spielzeug auf dem Boden liegt.
Nach kurzer Zeit verlässt die Mutter den Raum und das Kind bleibt mit der Testerin und dem Spielzeug alleine.
Die eigentliche wichtige Beobachtung ist allerdings nicht der Moment des Verlassenwerdens, sondern die Reaktion des Kindes, wenn die Mutter nach etwa drei Minuten zurückkehrt.
Babys reagieren sehr unterschiedlich auf die Rückkehr ihrer Mutter — und aus dieser Reaktion lassen sich Rückschlüsse ziehen, wie sicher gebunden sie sind.
Auf der Basis dieses Tests konnte Mary Ainsworth zunächst drei unterschiedliche Bindungsstile definieren: sicher, unsicher-vermeidend, unsicher-ambivalent.
Später fügte sie eine vierte Kategorie hinzu, weil bei ihren Untersuchungen das Verhalten einiger Kinder in keine der drei ersten passte: das desorganisierte Bindungsmuster.

Die vier Bindungsstile im Überblick
1) Das sicher gebundene Kind
Das sicher gebundene Kind fängt in der Regel zu weinen an, wenn seine Mutter den Raum verlässt, und will ihr folgen, beruhigt sich dann aber schnell wieder.
Es lässt sich von der Testerin trösten und spielt mit ihr. Sobald die Mutter zurückkehrt, freut es sich, sucht kurz den Körperkontakt, um sich davon zu überzeugen, dass sein „sicherer Hafen“ wieder da ist, und setzt dann sein Spiel oder die Erkundung des Untersuchungsraums fort.
Sicher gebundene Kinder sind neugierig und offen für Neues.
Sie sind ausgeglichen, können sich entspannen und haben die Erwartung, dass jemand für sie da ist, wenn sie Bedarf haben.
Merkmale im Erwachsenenalter:
- Fähigkeit zu vertrauensvollen Beziehungen
- Gutes Selbstwertgefühl
- Offen für Nähe und Intimität
2) Das unsicher vermeidend gebundene Kind
Das unsicher-vermeidend gebundene Kind schaut kaum vom Spiel auf, wenn seine Mutter den Raum verlässt, und reagiert auch so gut wie gar nicht bei ihrer Rückkehr.
Die Testerin ignoriert es in jeder Phase der Untersuchung.
Cooles Kind, könnte man meinen, aber unter seiner Oberfläche brodelt es: Die Konzentration des Stresshormons Cortisol im Speichel des Kindes schießt in dem Moment, in dem die Mutter den Raum verlässt, nach oben und ist auch noch Stunden später stark erhöht.
Unsicher-vermeidend gebundene Kinder haben in ihrem kurzen Leben gelernt, dass sie die größte Zuneigung und Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie niemanden „zur Last“ fallen.
Die Zuwendungen der Mutter sind in der Regel spärlich und sie bekommen sie oft nur dann, wenn sie „brav“ sind.
Sie haben gelernt, dass sie alleine klarkommen müssen, gelten als „pflegeleicht“ und haben sich – als etwa einjähriges Kleinkind – bereits eine Schein-Autonomie aufgebaut, die ihnen mit großer Wahrscheinlichkeit ihr ganzes Leben lang das Gefühl von Ungebundenheit, aber auch von Einsamkeit vermitteln wird.
Denn ihre Grundstimmung ist Resignation: Liebe und Beziehungen tun weh, sind bedrohlich und werden zurückgewiesen, deswegen suchen sie gar nicht mehr danach.
Merkmale im Erwachsenenalter:
- Schwierigkeiten, emotionale Nähe zuzulassen
- Tendenz zur emotionalen Distanz
- Vermeidung von Abhängigkeit in Beziehungen
Das Kind in dir muss Heimat finden als Arbeitsbuch
Das Bestseller-Buch Das Kind in dir muss Heimat finden* der Psychologin Stefanie Stahl als gut durchdachtes und klar konzipiertes Arbeitsbuch.
Es ist eine tolle Ergänzung zum Original-Buch, kann aber auch unabhängig davon allein genutzt werden.
3) Das unsicher ambivalent gebundene Kind
Das unsicher-ambivalent gebundene Kind ist völlig außer sich, wenn die Mutter den Raum verlässt.
Es schreit und weint, trommelt gegen die Tür, durch die die Mutter gegangen ist, und ist im wahrsten Sinn des Wortes untröstlich, denn auch die Testerin kann es nicht beruhigen. Der Cortisolspiegel in seinem Speichel schießt in die Höhe und ist auch noch Stunden später deutlich erhöht.
Sobald die Mutter zurückkehrt, klammert es sich an sie und will sie gar nicht mehr loslassen, lässt sich aber trotzdem kaum beruhigen. Sein Stress-System ist am Limit, wobei seine Gefühle ganz offensichtlich zwischen rasendem Trennungsschmerz, Verlustangst und Wut auf die Mutter hin- und herpendeln.
Eine unsicher-ambivalente Bindung ist meistens ein Zeichen dafür, dass das Verhalten der Mutter dem Kind gegenüber nicht konstant ist: Liebevolle Zuwendung wechselt sich mit Phasen von Abwesenheit oder Genervtsein ab.
Das Kind hat deshalb gelernt, um die Aufmerksamkeit seiner Mutter mit Weinen und Schreien zu kämpfen; sie ist der Mittelpunkt seiner Welt.
Das behindert einerseits seine natürlich Neugier, mit der es die Welt erkunden will, andererseits hat es in seinem kurzen Leben schon verinnerlicht, dass es sich Liebe und Zuwendung hart erkämpfen muss und trotzdem immer wieder enttäuscht wird.
Merkmale im Erwachsenenalter:
- Starkes Bedürfnis nach Nähe und Bestätigung
- Angst vor Zurückweisung
- Emotionale Abhängigkeit
Dramaspiele
„ … Jede Beziehung bringt ein soziales Lernverhalten mit sich. Das heißt: Wenn wir Dramaspiele unreflektiert mitmachen, trainieren wir unbewusst destruktive Verhaltensweisen.
Wer immer wieder erlebt, dass seine Bindung zu nahestehenden Personen auf Schuldgefühlen beruhen, wird bei unsicheren Bindungen versucht sein, selbst die Opferrolle einzunehmen. Indem man sich schwach und hilflos gibt, so die Erfahrung, zwingt man das Gegenüber in die Retterrolle und zugleich in eine Bindung. Nicht aus böser Absicht. Einfach nur deshalb, weil man die Manipulation als Beziehungskit verinnerlicht hat …“
Aus: Cornelia und Stephan Schwarz: Schluss mit Psychospielchen*
4) Das desorganisiert gebundene Kind
Das desorganisiert gebundene Kind ist jene vierte Kategorie, die Mary Ainsworth nachträglich zu den Bindungsstilen hinzugefügt hat, da ihr im Laufe ihrer Untersuchungen Kinder aufgefallen waren, deren Verhalten zu keiner der anderen drei Kategorien passte.
Die Kinder der desorganisiert-gebundenen Kategorie zeigen bei der Rückkehr der Mutter sehr auffällige Verhaltensweisen: Sie werfen sich auf den Boden, drehen sich im Kreis, machen schaukelnde Bewegungen, wie man sie bei Kindern mit Hospitalismus kennt, oder klammern sich an die Testerin.
Ihr seltsames Verhalten ist Ausdruck ihrer inneren Zerrissenheit: Einerseits möchten sie zu ihrer Mutter, um von ihr beschützt und geliebt zu werden, andererseits ist sie die Quelle ihrer größten Angst, vor der sie fliehen wollen.
Viele Kinder mit diesem Bindungsmuster sind Hochrisiko-Kinder, die selbst bereits Misshandlungs- oder Missbrauchserfahrungen gemacht haben, oder deren Mütter schwer traumatisiert sind oder beispielsweise an Depressionen leiden.
Traumatisierte Mütter und ihre Kinder verstricken sich oft immer tiefer in einem Teufelskreislauf, denn das Kind nimmt die Unruhe seiner Mutter wahr, wird deshalb selbst unruhig und überfordert dadurch seine immer verzweifelter werdende Mutter, die weder sich noch ihr Kind beruhigen kann.
Der Cortisolspiegel dieser Kinder ist dauerhaft erhöht. Sie leben oft ihr ganzes Leben in Alarmbereitschaft und mit dem ständigen Gefühl, dass jederzeit etwas Schlimmes passieren kann.
Merkmale im Erwachsenenalter:
- Schwierigkeiten, stabile Beziehungen zu führen
- Impulsives oder selbstschädigendes Verhalten
- Neigung zu Angst- und Persönlichkeitsstörungen
Bindungsmuster: Auswirkungen auf unser Erwachsenenleben
Die erste Bindung in unserem Leben – meist zur Mutter oder einer frühen Bezugsperson – ist die wichtigste in unserem Leben.
Sie ist die Blaupause für das Bindungsmuster, dem wir unbewusst folgen, wenn wir als Erwachsene Beziehungen eingehen. Ob liebevoll und sicher oder konflikthaft und unsicher – was wir früh gelernt haben, wird zu unserem inneren Muster für Nähe und Vertrauen.
Diese frühkindlich verankerten Bindungsmuster laufen oft automatisch ab – ähnlich wie das Autofahren: Wir denken nicht mehr über jeden Schritt nach, sondern folgen gewohnten Abläufen. Das macht vieles einfacher, kann aber in zwischenmenschlichen Beziehungen zu echten Schwierigkeiten führen.
Denn Bindungsmuster sind nicht nur Verhaltensgewohnheiten – sie sind emotionale Reaktionsmuster, die sich tief ins Unterbewusstsein eingegraben haben. Sie beeinflussen, wie wir lieben, streiten, Nähe zulassen oder ablehnen.
Die hohe Kunst in Beziehungen
„ … Es ist eine hohe Kunst, in Beziehungen zu lernen, nicht alles persönlich zu nehmen. Nach meiner Einschätzung haben 90 Prozent der Reaktionen, die wir in Beziehungen zeigen, nichts mit unserem Partner zu tun, sondern ergeben sich aus unserer Geschichte.“
Aus: Dami Charf, Auch alte Wunden können heilen: Wie Verletzungen aus der Kindheit unser Leben bestimmen und wie wir uns davon lösen können*
Auch alte Wunden können heilen: Bindungsmuster erkennen, verstehen — und verändern
Solange Beziehungen funktionieren, werden diese Muster selten hinterfragt.
Doch wenn Beziehungen scheitern, immer wieder ähnlich schmerzhaft verlaufen oder uns emotional auslaugen, lohnt es sich, genauer hinzusehen:
- Menschen, die unter grundloser Eifersucht leiden oder ihrem Partner ständig Vorwürfe machen
- On/Off-Beziehungen, die in einem kräftezehrenden Kreislauf feststecken
- Männer und Frauen, die Nähe vermeiden und sich emotional entziehen
- Perfektionismus, Getriebenheit oder ein tiefes Gefühl innerer Leere
All das kann Ausdruck eines dysfunktionalen Bindungsmusters sein, das aus frühen Erfahrungen stammt.
Die gute Nachricht: Muster lassen sich erkennen – und verändern. Nicht, um Schuldige zu suchen, sondern um sich selbst besser zu verstehen und neue Wege zu ermöglichen.
Denn: Auch alte Wunden können heilen.
Mehr lesen:
“Double Bind” — egal was du tust, es wird das Falsche sein — ist die Masche, mit der Narzissten ihre Mitmenschen manipulieren. Aber was ist Narzissmus, woher kommt er und wie kann man mit narzisstischen Persönlichkeiten umgehen?
Das Zeitalter der Narzissten
Copyright: Agentur für Bildbiographien, www.bildbiographien.de 2020, überarbeitet 2025
Buchempfehlungen:
Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affilate-Links, die helfen, den Blog Generationengespräch zu finanzieren. Wenn Ihnen eine der angegebenen Empfehlungen gefällt und Sie das Buch (oder ein anderes Produkt) über diesen Link bestellen, erhält der Blog dafür eine kleine Provision, ohne dass für Sie Mehrkosten entstehen. Für Ihren Klick: Herzlichen Dank im Voraus!
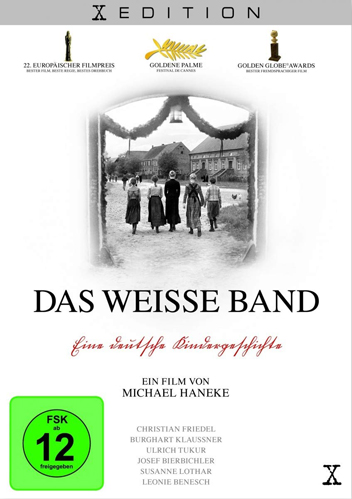
Ein sehr bewegender Film über die “Schwarze Pädagogik”, die viele Jahrhunderte lang ganz selbstverständlich Kindheit und Erziehung prägte.
Zum Amazon-Angebot:
Michael Haneke, Das weiße Band*, 2010. DVD, FSK: ab 12 Jahren oder als Prime Video*
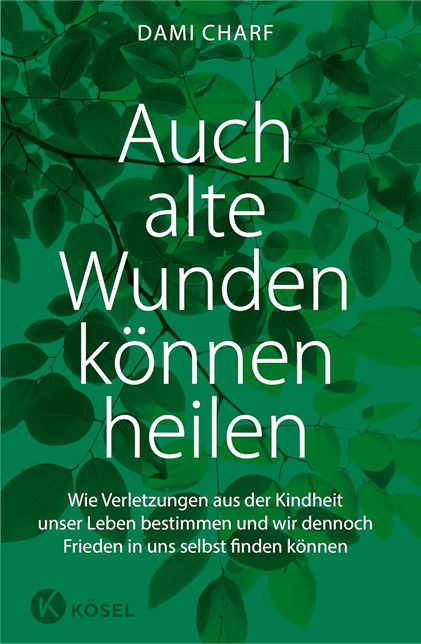
Kein Lob annehmen können, sich immer für alles “schuldig” fühlen, nicht zur Ruhe kommen und in der Liebe unglücklich sein — vieles, was uns in schlechten Phasen zu schaffen macht, hat seine Wurzeln in längst vergessenen Kindheitserlebnissen.
Die Trauma-Therapeutin Dami Charf beschreibt in ihrem Buch, welche Mechanismen uns immer wieder in alte Muster zurückfallen lassen. Und wie man daraus wieder herauskommt. Lesenswert!
Zum Amazon-Angebot:
Dami Charf, Auch alte Wunden können heilen: Wie Verletzungen aus der Kindheit unser Leben bestimmen und wie wir uns davon lösen können* Kösel Verlag, 2018
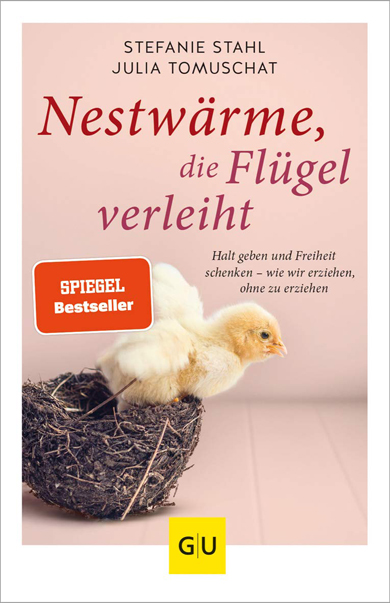
Stefanie Stahl, Autorin des Bestsellers Das Kind in dir muss Heimat finden*, mit ihrem neuen großartigen Buch über Kindererziehung. Sehr informativ und klar strukturiert mit vielen Beispielen aus der Praxis. Sehr lesenswert!
Zum Amazon-Angebot:
Stefanie Stahl, Julia Tomuschat, Nestwärme, die Flügel verleiht: Halt geben und Freiheit schenken — wie wir erziehen, ohne zu erziehen*, GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH, 2018
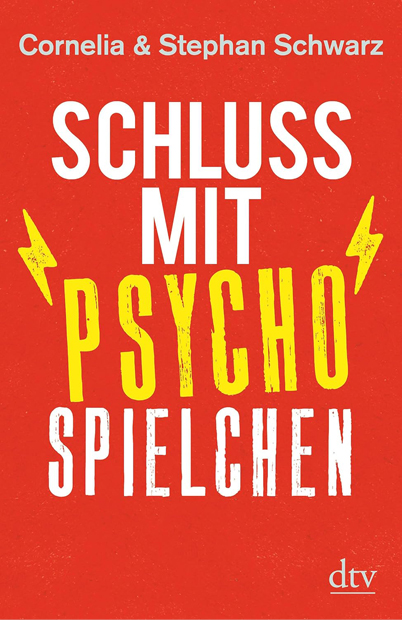
Opfer — Retter — Verfolger. In Stressituationen fallen wir oft in alte Rollen-Muster, die wir in der Kindheit gelernt haben, zurück. Wie man Psychospielchen durchschauen und durchbrechen kann: Ein sehr lesenswertes Buch mit vielen Fallbeispielen für alle, die das Gefühl haben, sich immer wieder an der gleichen Stelle zu verhaken.
Zum Amazon-Angebot:
Cornelia und Stephan Schwarz: Schluss mit Psychospielchen*, dtv Verlagsgesellschaft, Januar 2018
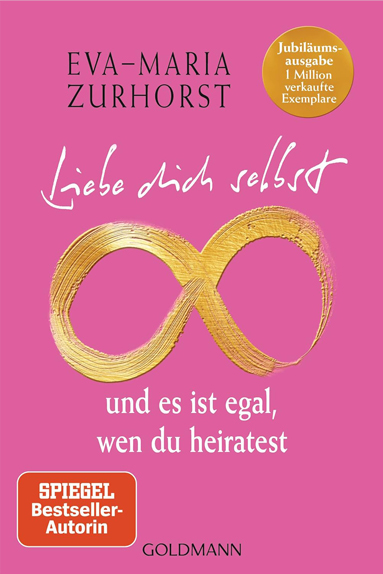
Wie groß ist unser Anteil an einer gescheiterten Liebe?
Ein spannender Beziehungsratgeber, der den Blick vom “bösen” Partner auf unsere eigenen Muster und Bedürfnisse lenkt.
Zum Amazon-Angebot:
Eva-Maria Zurhorst, Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest*, Goldmann Verlag, 2024, oder als Hörbuch* (kostenlos im Probemonat)
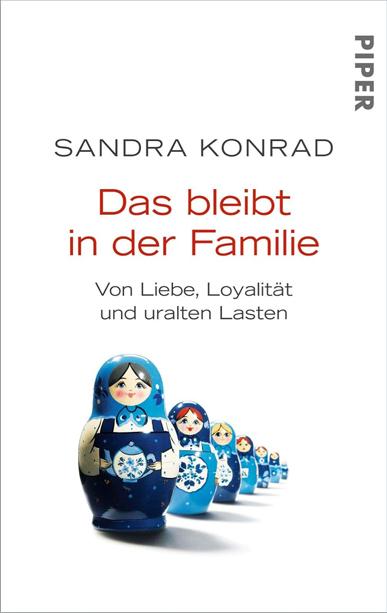
Ob Vorfahren sich an der Gesellschaft oder an der Familie schuldig gemacht haben — das Leben der Nachkommen wird von dieser Hypothek belastet sein”.Die Psychologin Sandra Konrad über unser unsichtbares transgenerationales Erbe, das unser Leben beeinflusst. Ein sehr lesenswertes Buch über Liebe, Loyalität und die Auswirkungen alter Belastungen — und wie man sie überwinden kann. Empfehlenswert!
Zum Amazon-Angebot:
Sandra Konrad, Das bleibt in der Familie: Von Liebe, Loyalität und uralten Lasten*, Piper Taschenbuch, 2014 oder als Hörbuch/Audible* (kostenlos im Probemonat)
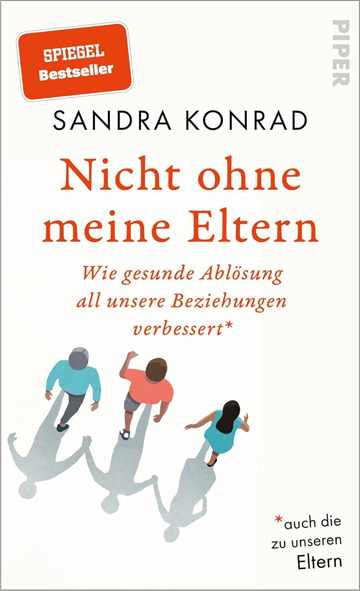
Alte Wunden aufdecken, Verpflichtungen und gegenseitige Erwartungen überdenken und gegebenenfalls aufgeben. In ihrem neuen, sehr lesenswerten Buch beleuchtet die Psychologin Sandra Konrad die Beziehung zwischen Eltern und ihren erwachsenen Kindern. Was man ändern kann und was man ändern sollte, um einen neuen, liebevolleren Umgang miteinander — und auch mit sich selbst — zu finden. Sehr empfehlenswert!
Zum Amazon-Angebot:
Sandra Konrad, Nicht ohne meine Eltern: Wie gesunde Ablösung all unsere Beziehungen verbessert – auch die zu unseren Eltern*, Piper, März 2023 oder als Hörbuch/Audible* (kostenlos im Probemonat)
Weiterführende Beiträge:
People Pleasing ist der Drang, es allen anderen recht zu machen. People Pleaser sind sehr empathische und hilfsbereite Menschen, die alles tun, damit es anderen gutgeht – bis sie nicht mehr können. Woher die Neigung zum People Pleasing kommt, welche Folgen es für Betroffene hat und welche Strategien helfen können, öfter „Nein“ zu sagen.
People Pleasing: Es allen anderen recht machen
Kindheit in den 1950er und 1960er Jahren: Die Wirtschaftswunderjahre gelten bis heute als glückliche Zeit. Mit Polka-Dots, Petticoat-Kleidern, Nierentischen und viel Pastell sind sie auch optisch eine Zäsur zu den tristen Kriegsjahren.
Aber der schöne Schein trügt. Für die meisten Kinder, die in den 1950er und 1960er Jahre aufwachsen, ist diese Zeit alles andere als glücklich.
Warte nur, bis Vati kommt …! Kindheit in den 1950er und 1960er Jahren
Geschwister: Erstgeborener oder jüngstes Kind? Egal, ob wir ewige Rivalität oder immerwährende Liebe zu unseren Geschwistern pflegen, nicht nur der Charakter unserer Beziehung ist von Bedeutung, sondern auch unser Platz in der Geschwisterreihenfolge.
Kleine Schwester, großer Bruder: Geschwisterkonstellationen
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit! Über mütterliches Bindungsverhalten und kleine Veränderungen an der DNA, die Stress und Trauma an die Nachkommen weitergeben können. Warum es aus Sicht der Evolution manchmal sogar sinnvoll sein kann, wenn Mütter ihre Kinder vernachlässigen — und weshalb wir trotzdem eine Wahl haben.
Epigenetik und transgenerationale Vererbung: Wenn Mütter nicht lieben
Männer: Geben sich Frauen als Mütter selbst ein “Lebenslänglich”? Opfern sie sich auf, werden dadurch unglücklich und nörgeln schließlich ihre Männer aus dem Haus? Über den schwierigen Spagat zwischen Kind und Kegel, Aufopfern, Hausarbeit, Oropax und die mütterlichen Qualitäten von Vätern.
Der Mann in der Krise
Bildnachweise:
Agentur für Bildbiographien
Generationengespräch
Geschichte und Psychologie
Vergangenes verstehen, um mit der Zukunft besser klar zu kommen.

Dr. Susanne Gebert
Generationengespräch
Agentur für Bildbiographien
Geschenke made for Mama
Geschichte & Psychologie
Die Vergangenheit verstehen, um mit der Zukunft besser klar zu kommen

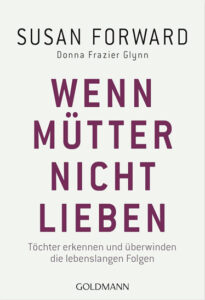

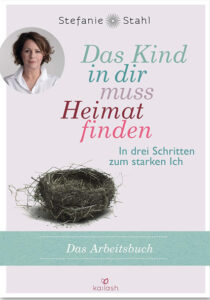
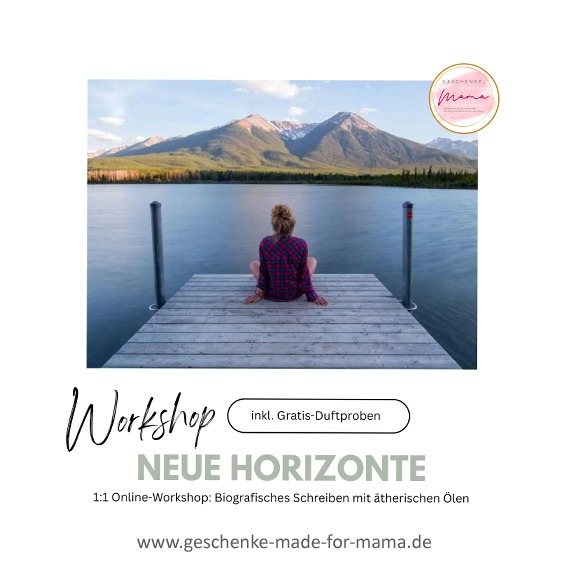
Toll geschrieben. Mir ist das zwar alles ganz klar, aber so komprimiert sehr gut zu verstehen.
Liebe Grüße
Ja, da kann ich dem Kommentar von Christiane uneingeschränkt zustimmen.
Ich hätte gern noch weitergelesen zu den Bindungstypen in Verknüpfung mit den Inneren Arbeitsmodellen in Bezug auf das Erwachsenenalter. Die Buchtipps sind dafür gut, “verwässern” aber wieder etwas die oben dargestellte Kompaktheit.
Vielen Dank!